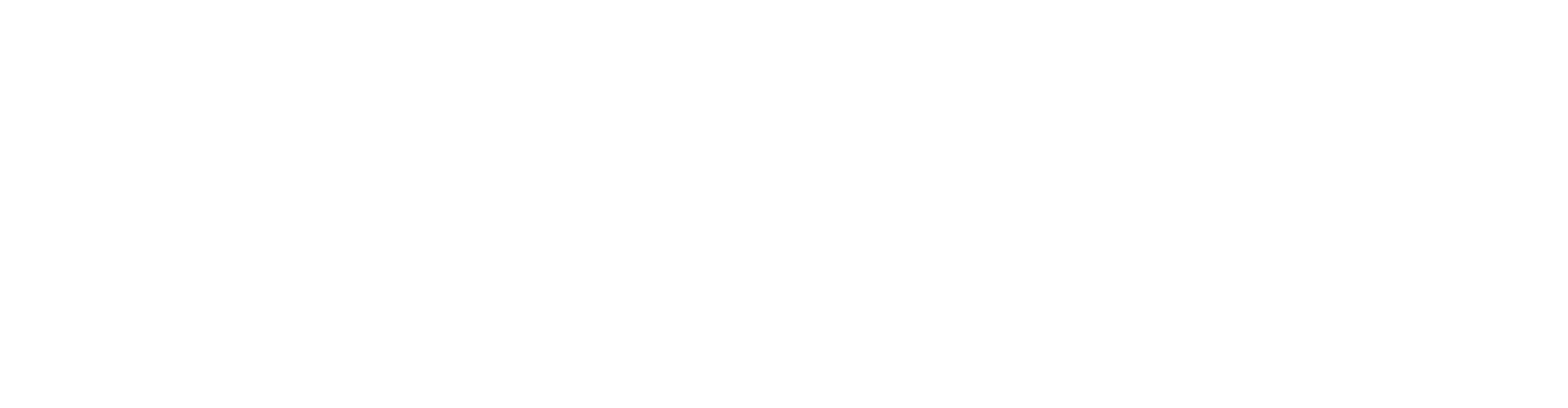STOPP FREMDWASSER
Stopp Fremdwasser!
Fremdwasser – ein ökologischer Sündenfall
Sauberes Wasser, das in das Abwassersystem fliesst,
wird in der Fachsprache «Fremdwasser» genannt.
Aber sauberes Wasser hat im Abwasser nichts zu suchen.
Worum geht es?
Aus ökologischer Sicht ist es unsinnig, sauberes Wasser der Umwelt zu entziehen, der Kanalisation zuzuführen, es dadurch zu verschmutzen und anschliessend wieder zu reinigen. Fremdwasser vermindert zudem die Reinigungsleistung der Kläranlagen, wodurch mehr Schadstoffe in die Gewässer gelangen.
Aus diesen Gründen besteht bereits seit 30 Jahren eine gesetzliche Verpflichtung, Fremdwasser von der Kanalisation fernzuhalten bzw. bestehende Einleitungen zu eliminieren.
Die Verursacher – in erster Linie Liegenschaftsbesitzer:innen und Gemeinden – sind dieser Verpflichtung jedoch bisher nicht oder nur ungenügend nachgekommen. Schätzungsweise die Hälfte der privaten Entwässerungsleitungen ist schadhaft oder undicht. Das Ausmass der Fremdwasserproblematik ist daher beachtlich: Der Mittelwert des Fremdwasseranteils im Abwasser im Gebiet des ZASE beträgt etwa 74 %.
Das heisst, dass auf einen Teil Schmutzwasser, drei Teile Sauberwasser entfallen!

So entsteht Fremdwasser
Fremdwasser kann aus verschiedenen Gründen ins Abwassernetz gelangen. Zu den häufigsten gehören:
-
Eintritt von Grundwasser infolge defekter Kanalisationsanlagen, speziell in Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel.
-
An die Kanalisation angeschlossene Sauberwasserquellen und Einleitungen, wie z.B.
-
Sickerleitungen, welche an die Kanalisation angeschlossen werden;
-
Brunnen-, Quell-, Reservoir- und Bachüberläufe, die in die Kanalisation führen;
-
Heiz- und Kühlwasser, das in die Kanalisation eingeleitet wird;
-
Grundwasserentnahmen, welche in die Kanalisation eingeleitet werden, um den Grundwasserspiegel abzusenken.
-

Die Folgen sind beachtlich
Gerade in Zeiten des Klimawandels mit länger werdenden Trockenperioden stellt die Verschwendung von sauberem Wasser, das zum Teil Trinkwasserqualität hat, ein Problem für Natur und Landwirtschaft dar.
Das durch Fremdwasser verdünnte Schmutzwasser verringert zudem die Reinigungsleistung der Kläranlagen, bei gleichzeitiger Erhöhung des Energiebedarfs. Beim Auslauf aus der ARA gelangen somit mehr Schadstoffe in die Umwelt.
Die Regenbecken, Pumpwerke und Kläranlagen müssen aufgrund des Fremdwassers grösser dimensioniert werden, um die grösseren Wassermengen zu bewältigen. Damit verbunden sind höhere Investitions- und Unterhaltskosten für die Gebührenzahler:innen. Dies wird speziell bei der notwendigen Nachrüstung einer Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen zum Tragen kommen.

Für Private + Gewerbe + Industrie
Für die privaten Abwasserleitungen bis zum Anschluss an das Gemeindenetz (über ihre Grundstücksgrenze hinaus) sind laut Gesetz die Grundeigentümer verantwortlich.
So reduzieren Sie den Fremdwasseranteil
Grundsätzlich gibt es zwei Mittel zur Verringerung des Fremdwasseranteils in den Kläranlagen:
-
Sanierung undichter Kanalisationsleitungen
-
Versickerung vor Ort oder Einleitung des sauberen Wassers in Bäche und Flüsse
Nur wenn die örtlichen Verhältnisse eine Ableitung in ein Gewässer (oder Sauberwasserleitung) oder eine Versickerung nicht erlauben, kann die kantonale Gewässerschutzbehörde für die Einleitung in die Kanalisation eine Ausnahme erteilen.
Regenwasser gilt dabei grundsätzlich nicht als Fremdwasser, da es nicht stetig anfällt. Sinnvollerweise würde man es aber wie Fremdwasser behandeln, wobei es vorgängig unter Umständen behandelt werden muss.
Wer ist zuständig?
Die Kontrolle, der ordnungsgemässe Betrieb, der Unterhalt und die Sanierung der Kanalisationsleitungen ist Sache der jeweiligen Eigentümer:innen.
-
Für die privaten Abwasserleitungen bis zum Anschluss an das Gemeindenetz (über ihre Grundstücksgrenze hinaus) sind laut Gesetz die Grundeigentümer:innen verantwortlich.
-
Für das gemeindeeigene Netz ist die Gemeinde zuständig.
-
Für das übergeordnete Netz und die Kläranlage ist der Zweckverband zuständig.
Die Gemeinden haben die Aufsicht über die privaten Abwasserleitungen inkl. Anschluss an das Gemeindenetz. Damit der Fremdwasseranteil in den Kläranlagen nachhaltig gesenkt werden kann, ist eine Sanierung der öffentlichen und der privaten Netze sowie die Elimination von Fremdwasserquellen notwendig.
Wie vorgehen?
Grundsätzlich wird beim Vorgehen unterschieden zwischen Neu- und Umbauten resp. bestehenden Bauten.
-
Bei Neu- und grösseren Umbauten prüft die Gemeinde, ob die Entwässerung privater Liegenschaften richtig ausgeführt worden ist. Die Kontrolle umfasst nicht nur die richtige Ausführung, sondern auch den Zustand der privaten Entwässerungsanlagen. Die Liegenschaftsbesitzer:innen haben den gesetzeskonformen Zustand sicherzustellen.
-
Bei bestehenden Bauten muss die Gemeinde ein Konzept für die Zustandserfassung privater Anlagen (ZpA) erstellen. Auf dieser Grundlage kann der Entscheid über die Sanierung der Leitungen getroffen werden. Die Sanierung wird verfügt. Die Kosten für die Untersuchung und Sanierung hat grundsätzlich der Grundeigentümer zu tragen.
Im Kanton Bern ist es im Gegensatz zum Kanton Solothurn so, dass sich der Kanton finanziell an Massnahmen zur Fremdwasserbeseitigung beteiligt (wobei die Einwohner:innen auch eine kantonale Abwasserabgabe zu entrichten haben).

Für Gemeinden
Sauberes Wasser, das in das Abwassersystem fliesst, wird in der Fachsprache «Fremdwasser» genannt. Aber sauberes Wasser hat im Abwasser nichts zu suchen.
Pflichten und Aufgaben
Um eine gesetzeskonforme Siedlungsentwässerung auf ihrem Siedlungsgebiet zu gewährleisten, sind die Gemeinden verpflichtet, einen sogenannten Generellen Entwässerungsplan (GEP) zu erstellen. Mit dem GEP ist ein Konzept zur Planung, zum Betrieb und Unterhalt des öffentlichen Abwassernetzes somit grundsätzlich in jeder Gemeinde vorhanden. Im Rahmen des GEP müssen die Gemeinden auch Massnahmen zur Fremdwasserreduktion vorsehen.
Die gesetzlichen Grundlagen auf kommunaler Ebene sind in einem Abwasserreglement festgelegt, das die Rechte und Pflichten der Gemeinde und der privaten Liegenschaftsbesitzer regelt. Der Kanton Solothurn stellt seinen Gemeinden ein solches Musterreglement zur Verfügung, das beispielsweise auch die Möglichkeit zur Erhebung einer mengenabhängigen Fremdwassergebühr vorsieht. Gleiches ist auch für die Gemeinden im Kanton Bern möglich.
Öffentliches und privates Netz gleichzeitig überprüfen
Im Rahmen des GEP legt die Gemeinde fest, wie sie ihr Abwassernetz prüft, unterhält und bei Bedarf saniert. In der Regel werden die Leitungen alle 10 bis 15 Jahre mittels Kanalfernsehuntersuchungen geprüft. Mit der Kontrolle des öffentlichen Netzes sind sinnvollerweise gleichzeitig die privaten Anschlussleitungen zu prüfen. Das schafft Synergien. Auf Grundlage dieser Untersuchungen kann der Entscheid über die Sanierung der Leitungen getroffen werden. Die Sanierung der privaten Leitungen wird durch die Gemeinde verfügt. Die Kosten für die Untersuchung und Sanierung haben grundsätzlich die Grundeigentümer:innen zu tragen. Den Gemeinden ist aber zu empfehlen, dass sie als Anreiz die Kosten für die Zustandsuntersuchung aus den Abwassergebühren übernehmen. Damit ist eine systematische Zustandserfassung aller Leitungen auf dem gesamten Gemeindegebiet möglich.
Elimination von Einzelquellen
Neben der Sanierung von undichten Kanalisationsleitungen kommt auch der Elimination von einzelnen Sauberwasserquellen grosse Bedeutung zu. Sauberes Wasser von Sickerleitungen, Brunnen, Grundwasserentnahmen etc. soll, wenn möglich, versickert oder in Bäche abgeleitet werden. Einige Massnahmen können rasch und kostengünstig umgesetzt werden, bei anderen empfiehlt sich eine sorgfältige Situationsanalyse und eine langfristige Planung, z.B. im Rahmen der Generellen Entwässerungsplanung.
Hürden bei der Behebung der Fremdwasserproblematik
Die privaten Grundeigentümer:innen sind sich zumeist nicht oder zu wenig bewusst, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihr eigenes Leitungsnetz intakt zu halten. Zudem lohnt es sich für sie in den meisten Fällen kaum, Sanierungsmassnahmen zu ergreifen. Langfristig wirkt sich ein intaktes Abwassernetz allenfalls positiv auf die Höhe der Abwassergebühren aus. Zu beachten ist allerdings, dass schadhafte Abwasserleitungen schlimmstenfalls zum Rückstau des Abwassers bis in den Keller führen können. Es ist deshalb primär wichtig, dass die Gemeinden transparent und ehrlich informieren und die Grundeigentümer:innen unterstützen.
Vorgehen
Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerfachleute (VSA) stellt Empfehlungen und Musterdokumente zur Verfügung: